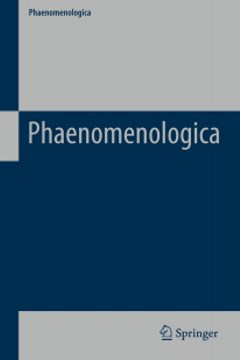Von der solipsistischen Egologie zur Phänomenologie der transzendentalen Intersubjektivität
pp. 3-12
Abstrakt
In seiner phänomenologischen Transzendentalphilosophie beansprucht Husserl, alle philosophische Erkenntnis auf rein egologische Fundamente gründen zu können. Der phänomenologische Charakter dieser Transzendentalphilosophie erlaubt es jedoch nicht, jenem ego von vornherein eine Allgemeinheit zuzuschreiben, die den auf seiner Grundlage entwickelten Philosophemen den Status intersubjektiver Verbindlichkeit garantieren würde. Diese Schwierigkeit führt Husserl zu der zunächst merkwürdig erscheinenden Differenzierung zwischen logischer Allgemeinheit und intersubjektiver Geltung (vgl. 14/306). Er formuliert damit jedoch ein Problem, das bis in die systematischen Anfangsgründe der phänomenologischen Philosophiekonzeption zurückreicht. Die Radikalität und Universalität der philosophieanfangenden Epoché setzt auch alle Wirklichkeiten außer Kraft, die den Namen anderes Subjekt oder anderer Mensch tragen und läßt sie nur als Phänomene in der Reduktion gelten. Damit können sie jedoch nicht als Subjekte aufgefaßt werden, für die eine philosophische Erkenntnis gültig oder ungültig sein kann.1 Wegen seiner methodischen Ausschaltung alles Ich-fremden scheint das phänomenologische Begründungsverfahren folglich einen Begriff intersubjektiver Wahrheit nicht zulassen zu können. In diesem Falle würde das phänomenologische Ich jedoch einen Geltungsanspruch für seine Erkenntnis erheben, der nur für es selbst von Bedeutung ist.
Publication details
Published in:
Römpp Georg (1992) Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität: und ihre Bedeutung für eine Theorie intersubjektiver Objektivität und die Konzeption einer phänomenologischen Philosophie. Dordrecht, Springer.
Seiten: 3-12
DOI: 10.1007/978-94-011-2819-3_1
Referenz:
Römpp Georg (1992) Von der solipsistischen Egologie zur Phänomenologie der transzendentalen Intersubjektivität, In: Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität, Dordrecht, Springer, 3–12.